INFOTHEK


EDITORIAL: Menschlichkeit und Sterben
Editorials | Infothek newsletter, editorial, tod
Editorial
Aus dem Newsletter Aug 2020. © JOLANDOS e.K. 2020Menschlichkeit und Sterben
Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,
in den letzten drei Monaten seit dem letzten Newsletter, hat nicht das Covid-19-Virus, sondern die von ihm ausgelösten Reaktionen der Menschen zu einem Polarisierungsprozess innerhalb unserer Gesellschaft geführt. Antrieb ist – wie so häufig – Angst. Auf der einen Seite verhärten die Menschen in ihrer Angst um Gesundheit und Leben, auf der anderen Seite aus Angst um humanistische Grundwerte wie Freiheit, Würde und Selbstbestimmung.Wie wohltuend ist es da, eine Stimme zu hören, die in ihrer ruhigen Besonnenheit das Wesentliche prägnant auf den Punkt bringt, ohne auch nur im geringsten vorwurfsvoll oder anklagend zu sein. Keine „Experten“-stimmen, sondern menschlich wirklich kompetente Stimmen, wie jene erzählende und still fragende Stimme der australischen Notfallmedizinerin Dr. Amaali Lokuge:

„Die größte Bedrohung, die vom Coronavirus ausgeht, ist vielleicht nicht seine Virulenz, sondern vielmehr die Art und Weise, wie es langsam untergräbt, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Soren Kierkegaard schrieb:
'Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, daß das Leben rückwärts verstanden werden muß. Aber darüber vergißt man den andern Satz, daß vorwärts gelebt werden muß.' (2).
Ich frage mich, wie die Covid-Zeit im Rückblick erscheinen wird.
Was jetzt noch als offensichtliche Fehler erscheint, mag einst als unvermeidliche Ausrutscher betrachtet werden. Jedes Land hat vielleicht sein eigenes mea culpa im Umgang mit einer Erkrankung, die in ihrer Unerbittlichkeit von der Menschheit niemals kontrolliert werden kann. Andere Entscheidungen, deren Bedrohung jetzt noch nicht sichtbar ist, könnten sich wiederum als am schwersten zu ertragen erweisen.
In Australien atmeten die Menschen nach der Lockerung der Restriktionen im Juni auf und schnappten nach Luft wie Frühlingszwiebeln. Es bestand das Gefühl, als wären wir einer Kugel ausgewichen. Nur im Krankenhaus ahnten wir, dass Covid uns wieder einholen würde. August, September, Oktober? Es war nur eine Frage der Zeit. Der erste Lockdown hatte uns nur eine Gnadenfrist verschafft: Zeit, um Vorräte anzulegen und uns vorzubereiten.
Anscheinend betäubt von einer permanenten Angst, wurde diese durch eine Stille und fatalistische Resignation ersetzt.
Ärzte und Krankenschwestern sind krank geworden, manchmal von der Arbeit, manchmal von der Übertragung selbst. Viele von ihnen sind zurückgekehrt und kümmern sich weiterhin um Covid-Patienten.
Werden wir die Krankheit auch bekommen? Sehr wahrscheinlich. Aber zumindest wissen wir, dass die meisten von uns sich erholen werden. Vielleicht war im März das Unbekannte so beängstigend.
Hier in Victoria sind wir gerade dabei, einen zweiten Anstieg von Infektionen in den Griff zu bekommen. Ähnlich wie im Rest der Welt werden auch hier die Schwächsten durch das Virus dezimiert. Die Pflegeheime sind zusammengebrochen, und die alten Menschen sterben zu schnell. Glücklicherweise hat das Gesundheitssystem nach monatelanger Vorbereitung immer noch Kapazitäten, aber wenn wir die Zahlen nicht kontrollieren, werden uns die unnötigen Todesfälle verfolgen.
Trotzdem frage ich mich, ob wir gerade durch den Versuch, die Verbreitung zu unterdrücken, es dem Virus – dem Gegenteil Menschlichkeit – ermöglichen, letztlich doch zu triumphieren? Für mich liegt die größte Bedrohung von SARS-CoV-2 nicht in seiner Virulenz, sondern in der Art und Weise, wie dadurch langsam untergraben wird, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Zuerst stahl das Unterdrücken uns die Berührung und jene köstliche Nähe einer spontanen Umarmung. Dann stahl sie soziale Zusammenkünfte und gemeinsame Mahlzeiten. Und nun verlieren wir mit der Maskenpflicht sogar die wärmende Freude eines Lächelns, das wir mit Fremden teilen. Es scheint einfach nicht richtig, nur mir den Augen zu kräuseln, wenn sie gerade an uns vorübergehen.
Im Krankenhaus wird dieser Verlust noch deutlicher. Ich erinnere mich noch an die Katharsis, als ich im Mai eine Krankenschwester noch umarmte, die mir half, mich um einen Patienten zu kümmern, dessen Zustand sich unerwartet verschlechtert hatte. Jetzt stehen wir schweigend getrennt, abgeschirmt voneinander durch Schichten von PSA, in denen auch die Emotionen gefangen sind. Unsere Augen versuchen verzweifelt, den Stress zu vermitteln, der sich erst dann löst, wenn wir am Ende einer Schicht allein aus dem Kittel in Zivilkleidung wechseln.
Die Patienten erleben diese Isolation intensiv. Es wurden Regeln aufgestellt, um die Ausbreitung einzudämmen. Besucher sind nicht erlaubt.
Der erste kranke Covid-Patient, den ich in der Notaufnahme betreute, ein älterer Mann, lehnte die Intensivpflege ab, als klar wurde, dass seine Familie nicht bei ihm bleiben durfte. Sein Sohn flehte das Intensivpflegeteam an, ihm zu erlauben, bei seinem Vater zu bleiben. Zum Wohle der Allgemeinheit hielten wir uns aber an die Regeln. Panik erfasste das Gesicht des Patienten und verschwand solange nicht, bis sein Sohn ihm zusicherte, ihn nach Hause zu bringen.
Auch in Pflegeheimen haben Patienten ihre Familien seit Monaten nicht mehr gesehen. Wenn Video-Chats für uns seelenlos sind, wie muss es sich dann anfühlen, sich per Videolink zu verabschieden? Die Stimme einer jungen Ärztin brach, als sie mir ihren Tag beschrieb, wie sie mit ihrem iPad von einem Zimmer eines kranken oder sterbenden Patienten zum anderen ging, die Patienten digital mit ihren Verwandten zu Hause verband und immer wieder miterleben musste, wie die Familien an der Trauer zerbrachen.
Dies ist der Grund, warum ich meinen Vater, der in seinen 70ern ist und an Parkinson und Herzproblemen leidet, trotz des Risikos immer noch besuche. Als der Arzt in mir von ihm Isolation einforderte, sagte er mir mit Nachdruck, wenn er schon an Covid sterben müsse, würde er sich lieber von mir anstecken lassen. Und als Buddhist sagt er: 'Wir werden alle sterben, wegen des Virus könnte es nur ein wenig früher sein.'
Wir schlossen letztlich einen Kompromiss: Er bleibt zu Hause und ich liefere ihm zweimal pro Woche die Einkäufe. Umarme ich ihn, wenn ich ihn sehe? Natürlich umarme ich ihn. Würden Umarmungen gezählt werden, würden sie diese Zahl nicht auch erhöhen wollen?
Auch wenn wir darüber staunen und schimpfen, wie uns das Virus hier erwischt hat, macht das Ganze auch Sinn. Melbourne ist eine kosmopolitische, pulsierende Stadt, die in ihrer Verbundenheit und Seele schwelgt. Es scheint schier unmöglich, diesen Geist zu bändigen.
Die Gruppen, die sich im Park versammeln, sind nicht egoistisch oder böse, sie sind einfach nur menschlich. Der Virus durchzieht große Familien wie ein Lauffeuer, denn auch wenn wir es versuchen, das Bedürfnis, uns zu berühren, zu umarmen und zusammen zu sein, können wir nicht unterdrücken. Vielleicht ist das unser eigentlicher Widerstand gegen ein Virus, das uns schon so viel genommen hat.
Überraschenderweise beunruhigt mich als Mitarbeiter des Gesundheitswesens am meisten, dass wir beim Rückblick auf diese Covid-Zeit nicht von der Tatsache traumatisiert sein werden, dass so viele Menschen gestorben sind, sondern von der Art und Weise, wie wir sie allein haben sterben lassen.“ (1)
Gedanken, Bedenken und Hoffnungen in besonnen Worten mitgeteilt. Hier wird man zum Nachdenken nicht aufgefordert, sondern eingeladen. Eingeladen vor allem über Menschlichkeit und Sterben nachzudenken. Beides Phänomene, die ja untrennbar zu jedem ganzen Menschen gehören und deshalb gerade von den Vertretern der Osteopathie reflektiert werden sollten. Nicht in ihrer Rolle als Therapeutinnen und Therapeuten, sondern als die Menschen, die sie sind.
Ihr
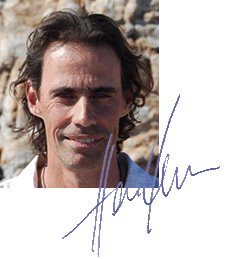
Christian Hartmann
kontakt@jolandos.de
Quellennachweise
- (1) https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/australia/melbourne-covid-doctor.html. Übers. von C. Hartmann. Abgerufen am 07.08.20.
- (2) Die Tagebücher. Deutsch von Theodor Haecker. Brenner-Verlag 1923, S. 203.
Bildquellen
- Dr. Amaali Lokuge. Abgerufen am 28.06.20

